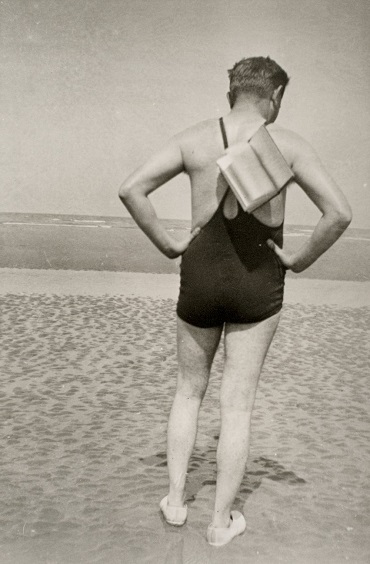Das Lesezimmer
Im Herzen von Kolumba befindet sich das Lesezimmer. Es ist ein Ort der Reflexion, der vertiefenden Lektüre, aber auch ein Ort des Austauschs und des Gesprächs. In einer neuen Veranstaltungsreihe nutzen wir es für eine informelle (Selbst-)Bildungsinitiative: Wir lesen monatlich ein Buch, einen Aufsatz oder einen Essay. Das Lesezimmer wird zum Ort, an dem wir uns treffen, um unsere Gedanken und Eindrücke zum Gelesenen auszutauschen und um Themen, die in der Ausstellung verhandelt werden, zu vertiefen. »Das Lesezimmer« findet immer am zweiten Donnerstag im Monat statt (17.30 bis 19 Uhr). Die Veranstaltung wird von unserem Gastkurator Andreas Speer (Professor für Philosophie an der Universität Köln) konzipiert und jeweils von wechselnden Gästen moderiert. Der Eintritt ist frei. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft zur vorausgehenden Lektüre. Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine Mail an: mail@kolumba.de
12. Januar 2023, 17.30 Uhr
Christan Feldbacher – Michael Köhlmeier: Wenn ich WIR sage. Über die Sprengkraft eines kleinen Wortes, 2019 (Ausschnitt)
Christian Feldbacher-Escamilla ist Geschäfsführer des Philosophischen Seminars der Universität zu Köln. Er hat in Salzburg, Innsbruck und Düsseldorf studiert und 2018 an der Universität Düsseldorf promoviert. Sein Fachgebiet liegt im Bereich der Erkenntnistheorie und der Wissenschaftstheorie, wo er sich besonders für Probleme der sozialen Erkenntnistheorie, des maschinellen Lernens interessiert.
9. Februar, 17.30 Uhr
Lars Reuke – Marshall Sahlins: The New Science of the Enchanted Universe. An Anthropology of Most of Humanity, 2022
Aus Sicht der westlichen Moderne lebt die Menschheit in einem desillusionierten Kosmos. Götter, Geister und Ahnen haben uns in ein transzendentes Jenseits verlassen, leben nicht mehr in unserer Mitte und sind in die Angelegenheiten des täglichen Lebens nicht involviert. Doch die große Mehrheit der Kulturen in der Geschichte der Menschheit betrachtet Geister als sehr reale Personen, als Mitglieder einer kosmischen Gesellschaft, die mit den Menschen interagieren und ihr Schicksal bestimmen. In den meisten Kulturen, auch heute noch, sind die Menschen nur ein kleiner Teil eines verzauberten Universums, das durch die Kategorien der "Religion" und des "Übernatürlichen" missverstanden wird. „Sahlins wirbt für eine neue Form des Animismus, der alle Kreaturen, manchmal sogar Steine, als handlungsmächtig und gleichberechtigt annimmt und ihnen den Respekt zollt, der ihnen im Westen als Teil der Natur versagt blieb.“ (Heike Berendt) Zusammen mit dem Philosophen Lars Reuke sprechen wir über das 2. Kapitel von The New Science of the Enchanted Universe, das letzte Buch des 2021 verstorbenen amerikanischen Anthropologen Marshall Sahlins.
9. März, 17.30 Uhr
André Grahle – Hannah Arendt: Wir Flüchtlinge, 1943
Hannah Arendts 1943 in der jüdischen Zeitschrift „Menorah Journal“ erschienener Essay „Wir Flüchtlinge“ wurde lange Zeit ignoriert und erst 1986 ins Deutsche übersetzt. Arendt beschreibt darin die Lebensgeschichte des jüdischen Flüchtlings „Herrn Cohn“. Im optimistischen Bestreben die Identität eines jeden Landes, in das sein Schicksal ihn verschlägt, von neuem anzunehmen, verliert der Protagonist den Bezug zu sich selbst und zu seiner Geschichte. Über den zeitgeschichtlichen Kontext des Essays hinaus analysiert Hannah Arendt Aspekte einer Grunderfahrung des Lebens im Exil, welche durch den Verlust der eigenen Sprache, sowie Einbußen der „Natürlichkeit unserer Reaktionen“, der „Einfachheit unserer Gebärden“ und des „ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle“ gekennzeichnet ist.
Gemeinsam mit André Grahle, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Universität zu Köln, werden wir Hannah Arendts Ausführungen schrittweise rekonstruieren und uns fragen, vor welche ethischen Herausforderungen sie Zufluchtsgesellschaften heute stellen.
13. April, 17.30 Uhr
Thomas Jeschke – Thomas Morus: Utopia (Ausschnitt)
Das Werk Utopia (1516) des englischen Humanisten Thomas More steht namentlich am Anfang einer bis heute reichenden literarischen Gattung: der utopischen Literatur. Auch wenn die als Dialog verfasste Schrift utopische Züge in unserem heutigen Verständnis aufweist, wäre es grob fahrlässig, Utopia als Utopie zu kennzeichnen. Vielmehr ist das ganze Werk in seiner Anlage darauf ausgelegt, „hinter“ die handelnden/sprechenden Personen, „hinter“ die utopischen Entwürfe und „hinter“ die offensichtliche Deutung des Werks zu blicken. Im Grunde lassen sich alle in Utopia behandelten Themen so lesen, dass die ursprüngliche Utopie durchbrochen wird und eine Dystopie durchscheint. Zusammen mit dem Philosophen Thomas Jeschke werden den Teil zur Außenpolitik aus dem ersten Buch und die Kriegsstrategien der Utopier aus dem zweiten Buch lesen. Wir werden uns fragen, ob die in Utopia erörterten Kriegsstrategien „utopisch“ sind bzw. in welchem Sinne sie es sein könnten, und wir werden uns fragen, ob Utopia als ganzes „utopisch“ ist bzw. wo die Grenzen der Utopie liegen. Zudem sollten wir uns abschließend mit Blick auf Ort & Subjekt fragen, welche (Nicht-)Räume in Utopia aufgemacht werden: Räume im Sinne der Kritik an den realen Zuständen, Räume des Entwerfens idealer Zustände oder etwas dazwischen – und ob bzw. was das alles mit uns zu tun hat.
11. Mai 17.30 Uhr
Martin Zillinger – Michael Rothberg: Multidirektionale Erinnerung: Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung
22. Juni (!), 17.30 Uhr
Gabriella Cianciolo Consentino – Marc Augé: Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit (Ausschnitt)
Der französische Ethnologe und Anthropologe Marc Augé (*1935) entwickelt in seinem 1992 erschienenen Werk Orte und Nicht-Orte ein Bild einer Gegenwart (Übermoderne), die durch »die Überfülle der Ereignisse, die Überfülle des Raumes und die Individualisierung der Referenzen« geprägt ist. Er beschreibt das Phänomen der Nicht-Orte, denen Identität, Relation und Geschichte fehlen. Sie bezeichnen einen Zustand der Durchreise und werden unter anderem durch Worte und Texte definiert, »die in Vorschriften (»rechts einordnen«), Verboten (»Rauchen verboten«) oder Informationen (»Herzlich willkommen im Beaujolais«) zum Ausdruck kommen«. Augé konstatiert eine zunehmende Orientierungslosigkeit, die daraus resultiert, dass Ziele wegen fehlender Standorte immer weniger zu definieren sind. Zusammen mit der Architekturhistorikerin Gabriella Cianciolo Cosentino lesen wir das letzte Kapitel von Orte und Nicht-Orte.
10. August, 17.30 Uhr
Andreas Speer – Judith Butler: Gewaltlosigkeit, Betrauerbarkeit und die Kritik des Individualismus
Judith Butlers Plädoyer für Gewaltlosigkeit wirkt auf den ersten Blick aus der Zeit gefallen und ist doch auf bestürzende Weise aktuell. Denn Butler verschließt nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Argumente für Gewaltlosigkeit setzen vielmehr Klarheit darüber voraus, wie Gewalt vorgestellt und in einem Feld diskursiver, gesellschaftlicher und staatlicher Macht zugeschrieben wird. Die Wurzel aller Gewalt sieht Butler in der Ungleichheit, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens betrifft. Zum Ernstfall wird die Betrauerbarkeit. Ein Leben muss betrauerbar sein, sein Verlust muss als Verlust benennbar sein. Eine Ethik der Gewaltlosigkeit setzt eine Ethik der Betrauerbarkeit voraus. Zusammen mit dem Philosophen Andreas Speer lesen wir das erste Kapitel aus Die Macht der Gewaltlosigkeit.